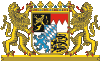Forschungs- und Innovationsprojekt
Effizienzsteigerung der Bewässerung von Gemüse und Obst durch Unterflurtropfsysteme

Auf gemüsebaulich bewirtschafteten Flächen und im Obstbau, insbesondere im Beerenobstanbau, besteht im Vergleich zu landwirtschaftlichen Kulturen ein weitaus höherer Wasserbedarf. Um die Produktion aufrecht zu erhalten und die Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen zu können ist in trockenen Anbaujahren eine Zusatzbewässerung zwingend notwendig. Insgesamt wird in den kommenden Jahren ein steigender Zusatzwasserbedarf erwartet. In der Regel werden Überkopfberegnungssysteme wie Kreisregner auf Rohrsystemen, bzw. mobile Beregnungsmaschinen mit Starkregner oder Düsenwägen verwendet. Knapper werdende Ressourcen und Wasserkontingente sind für viele Betriebe ein Anlass sich zunehmend mit Tropfbewässerungssystemen zu beschäftigen. Die Unterflurbewässerung (sub surface irrigation) mit „dauerhaft“ verlegten Tropfschläuchen bietet die Möglichkeit der Wassereinsparung und weitere Potentiale, bzw. Vorteile wie zum Beispiel Arbeitserleichterung, geringere Störanfälligkeit als einjährig genutzte und oberflächlich verlegte Tropfbewässerung, Optimieren des Nährstoffmanagements (Fertigation), weniger mechanische Unkrautbekämpfung und Einsparung von Pflanzenschutzmitteln sowie Möglichkeiten der Automatisierung.
Ziel des Projektes
Um das Potential zur Wassereinsparung in der Bewässerung weiter auszuschöpfen, soll eine Unterflurbewässerung mit „dauerhaft“ verlegten Tropfschläuchen getestet und in der Praxis etabliert werden. Das Projekt zielt darauf ab, im verfahrenstechnischen Vergleich von Tropfbewässerungsanlagen (Unterflur versus oberflächennah verlegte Tropfschläuche) und zu bisher genutzten Über-Kopf-Verfahren die Auswirkungen auf Kulturen, Bewässerungsregime, Ökologie und Ökonomie (Arbeits- und Unterhaltungsaufwand, Wirtschaftlichkeit) zu evaluieren. Neue, bzw. weiterentwickelte Verfahren der Auslegung und Bergung der Tropfschläuche sollen getestet werden. Das für die Etablierung der Unterflurtropfbewässerung notwendige Wissen soll in diesem Projekt zusammengefasst und sowohl der Beratung als auch der Praxis zur Verfügung gestellt werden.
Methode des Projektes
Im Projekt werden sowohl Exaktversuche auf den Versuchsflächen der Forschungseinrichtungen als auch Methoden des On-Farm-Research in den Praxisbetrieben zur Anwendung kommen. Eine Installation auf den Versuchsflächen der LWG und der HSWT ermöglicht detaillierte Untersuchungen, die auch nach Projekteende hinaus für Langzeitbeobachtungen fortgeführt werden können. Einflussfaktoren auf eine funktionierende Unterflurtropfbewässerung (v. a. Bodenart, Einbautiefe der Tropfschläuche, Bodenbearbeitung) werden validiert. Hierzu sind im Einzelnen folgende Bereiche zu untersuchen:
- Technische Aspekte der Unterflurbewässerung in Bezug auf die Planung und der Umsetzung in der Praxis. Welche Maschinen sind geeignet und inwieweit ist eine Eigenleistung möglich?
- Welcher Reihenabstand, Tropfabstand und welche Verlegetiefe ist für das Kulturspektrum geeignet?
- Bodenphysikalische Effekte in Bezug auf das Bodenbearbeitungskonzept und die Auswirkung auf die Bodenstruktur und Bodengare (Frostgare)
- Auswirkung auf die Fruchtfolgeplanung im gartenbaulichen und landwirtschaftlichen Kontext
- Auswirkung auf die Bestandsführung in Bezug auf die Beikrautentwicklung und mechanische Unkrautbekämpfung
- Pflanzenbauliche Aspekte in Bezug auf die Wasserversorgung nach Saat- und Pflanzung (Anschluss an den Kapillarraum, Homogenität des Bestandes, Pflanzengesundheit, Ertrag und Qualität sowie der Bestandsführung durch gezielte Wasser- und Düngergaben im Wurzelbereich)
- Ökonomische und ökologische Auswirkungen in Bezug auf die Einsparung von Ressourcen (Wasser, Diesel und ggf. Dünger)
- Vereinfachte Ökobilanz bei einjährigen und mehrjährigen Schlauchsystemen bezüglich der eingesetzten Ressourcen und Reststoffe
Projektinformationen
Projektleitung: Dr. Alexander Dümig (LWG-IEF 1)
Projektbearbeiter: Muhammad Hafeez Ul Barkat (LWG-IEF 1)
Laufzeit: 01.01.2025 – 31.12.2027
Finanzierung: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus
Projektpartner: Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT)
Förderkennzeichen: A/24/14