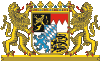Online-Veranstaltungen im Januar/Februar 2025
Online-Winterberichtsreihe: Aktuelles aus dem Arbeitsbereich Umweltgerechte Erzeugung

Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) lädt Sie herzlich zu ihrer Online-Winterberichtsreihe „Aktuelles aus dem Arbeitsbereich Umweltgerechte Erzeugung“ ein. Im Rahmen dieser Vortragsreihe werden in wöchentlichem Abstand im Januar und Februar 2025 verschiedene Forschungsthemen mit Schwerpunkt Gemüsebau präsentiert. Die 5 Online-Veranstaltungen finden ab 29.01.2025 bis 26.02.2025 jeweils am Mittwoch um 16:30 Uhr als Webex-Seminar statt und dauern ca. 1,5 Stunden.
Die Seminare sind kostenlos. Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung spätestens 5 Tage vor der jeweiligen Veranstaltung erforderlich ist. Den Anmeldelink finden Sie jeweils unter der Vortrags-Übersicht. Sie können selbstverständlich mehrere, bzw. alle Termine buchen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und den gemeinsamen Austausch!
Veranstaltungsprogramm
Vorträge am 29.01.2025:
Gemüsebauversuche des Kompetenzzentrums Ökogartenbau
Bereits seit dem Winter 2022/23 werden auf verschiedenen Praxisbetrieben wiederholt Arten evaluiert, die sich für die Winterbegrünung im geschützten Anbau eignen. Während anfänglich vor allem die allgemeine Eignung für die Wintermonate untersucht wurde, rückte in den weiteren Versuchsjahren die Fragestellung in den Fokus, welche Arten zusätzlich positive Effekte auf das Mikrobiom haben können und ob es gelingen kann, den pilzlichen Erreger, der die Korkwurzelkrankheit an Tomaten und Paprika hervorruft, durch eine Zwischenfrucht einzudämmen. Vorgestellt werden die bisher gewonnen Erkenntnisse und laufende Versuche zu diesem Thema.
In einem im Jahr 2023 begonnenen Langzeitversuch zum Thema minimale Bodenbearbeitung wird die flache Bearbeitung mit dem Geohobel mit einer intensiven „Standardbearbeitung“ verglichen. Neben der Auswirkung auf verschiedene Sä- und Pflanzkulturen wurden auch Effekte auf die Bodenchemie, -physik und -biologie untersucht sowie Erfahrungen zum Umgang mit dem Gerät gesammelt. Im Jahr 2024 konnten dazu bereits einige interessante Entwicklungen festgestellt werden, die hier zum Thema kommen.
In einem „Stresstest“ für die Zwiebel wurde untersucht, wie intensiv der Striegeleinsatz in der Zwiebel ausgeweitet werden kann, ohne den Zwiebelbestand zu groß zu schädigen. Dabei wurden verschiedene Techniken und Vorgehensweisen miteinander verglichen, um festzustellen, wie sich diese auf den Erfolg der Beikrautregulierung auswirken. Auch wenn aufgrund der Witterung im Anbaujahr aussagekräftige Ergebnisse noch ausstehen, so kann dennoch bereits von bisherigen Erfahrungen profitiert werden.
Das additive Intercropping bezeichnet die gezielte Integration von bestimmten Arten in den Hauptkulturbestand, um Nützlinge anzulocken und deren Effekt auf Schädlinge zu nutzen. Am Versuchsbetrieb Bamberg wurde bereits im zweiten Jahr eine Evaluierung geeigneter Arten hierfür durchgeführt. Parallel dazu wurde ein erster Versuch auf einem Praxisbetrieb gestartet, verschiedene Blühpflanzen in einen Kohlbestand zu integrieren und abzuschätzen, welchen Effekt es auf Nützlinge und Schäden am Kohl gibt.
Eine Reduktion des Thripsbefalls bei Porree wurde in diesem Versuch durch den Einsatz von Gräsern angestrebt. Auf einem Praxisbetrieb diente Gerste als Zwischenpflanzung im Porree, die die Thripse vom Porree abhalten sollte. Wie erfolgreich die Vorgehensweise war, wird hier diskutiert.

Anmeldung für die Vorträge am 29.01.2025 um 16:30 Uhr: Gemüsebauversuche des Kompetenzzentrums Ökogartenbau
Hier geht es zur Online-Anmeldung (Anmeldeschluss 24. Januar 2025):
Vorträge am 05.02.2025:
Autonome Hackroboter im Gartenbau
Die effiziente Regulierung von Beikräutern stellt eine wichtige Kulturmaßnahme dar, um ein ungestörtes Wachstum der Kulturpflanzen zu gewährleisten und somit hohe Erträge zu sichern. Zunehmende Einschränkungen des Herbizideinsatzes, ein Mangel an Saisonarbeitskräften und steigende Löhne stellen viele Anbauende vor die Frage, wie in Zukunft eine effektive Beikrautregulierung im Gartenbau gestaltet werden kann. Ein Lösungsansatz ist der Einsatz von autonomer Hacktechnik. Insbesondere in den letzten Jahren ist der Markt von Produkten zur autonomen Beikrautregulierung gewachsen. Im Rahmen des Forschungsprojekts "Innovative Methoden zur ökologischen Beikrautregulierung im Gartenbau“ testet die LWG verschiedene Hackroboter und führt Versuche in unterschiedlichen Gartenbaukulturen durch. Anlässlich des Projektabschlusses im Februar 2025 werden die Ergebnisse und Erfahrungen aus den letzten drei Versuchsjahren vorgestellt.

Anmeldung für die Vorträge am 05.02.2025, 16:30 Uhr: Autonome Hackroboter im Gartenbau
Hier geht es zur Online-Anmeldung (Anmeldeschluss 31. Januar 2025):
Vorträge am 12.02.2025:
Obstbauversuche und Düngebedarfsversuche bei Weihnachtsbäumen im Kompetenzzentrum Ökogartenbau
Welche Rolle spielt das Düngemanagement für das Wachstum und die Qualität von Weihnachtsbäumen? Mit dem Abschluss der Versuche zu Düngeart und Düngezeitpunkt beim Weihnachtsbaumanbau blicken wir auf überraschende Ergebnisse aus drei Jahren Versuchsarbeit auf zwei Praxisbetrieben in Bayern zurück.
Wie lässt sich der ökologische Heidelbeeranbau optimieren? Unsere aktuelle Forschung konzentriert sich darauf, welche Böden und Anbaumethoden verwendet werden können, um auf eigentlich ungeeigneten Standorten eine Ertragssicherheit gewährleisten zu können. Erhalten Sie Einblicke in die Zukunft des Heidelbeeranbaus – nachhaltig, ertragreich und umweltfreundlich!
Welche Erdbeersorten sind die Stars der nächsten Saison? Unser Sortenversuch prüft Geschmack, Ertrag und Resistenzen verschiedener Sorten unter realen Bedingungen. Lassen Sie sich von unseren Erkenntnissen inspirieren und erfahren Sie, welche Erdbeeren die besten Ergebnisse liefern.
Von der Pflege bis zur Ernte – wie kann der Haselnussanbau in Deutschland funktionieren und optimiert werden? Unsere Forschungsreihe umfasst Schnittversuche für Haselnussbäume, Erziehungsstrategien zur Kronenform und Erntetechniken für höchste Effizienz.

Anmeldung für die Vorträge am 12.02.2025 um 16:30 Uhr: Obstbauversuche und Düngebedarfsversuche bei Weihnachtsbäumen
Hier geht es zur Online-Anmeldung (Anmeldeschluss 7. Februar 2025):
Vorträge am 19.02.2025:
Ökologische Freiland- und Unter Glas-Versuche
Im zweiten Versuchsjahr wurden erneut sechs Fenchelsorten untersucht, darunter sowohl bereits bekannte als auch neue Varianten. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf die Knollenform gelegt, insbesondere auf die kugeligen und bauchigen Sorten. Um die Sorten zusätzlich hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Pflanztermine vergleichen zu können, wurden sie in einem frühen, einem Sommer- und einem späten Satz angebaut. Neben der Knollenform wurden auch die Haltbarkeit und die Schoßfestigkeit der Sorten eingehend betrachtet.
Kann mit selbst angebauten Körnerleguminosen betriebseigener Stickstoffdünger hergestellt und erfolgreich in einer Gemüsekultur eingesetzt werden? In diesem Versuch sollten die im letzten Jahr geernteten Leguminosen (Sojabohnen und Lupinen) als Stickstoffdünger für Winterwirsing verwendet werden. Dazu wurden die Leguminosen geschrotet und mit zwei handelsüblichen Düngemitteln (Horngrieß und Hornmehl) verglichen. Im Verlauf der Kultur wurden regelmäßige Bodenproben entnommen, um den Stickstoffgehalt im Boden zu analysieren. Zudem sollte eine Ertragserfassung zeigen, ob es Unterschiede zwischen den verschiedenen Düngemitteln gibt.
Im dritten Versuchsjahr zum Thema Untersaaten im geheizten Gewächshaus wurden zwei blühende Mischungen gewählt, die den eingesetzten und zugeflogenen Nützlingen und den Bestäuberinsekten Nahrung und Unterschlupf bieten könnten. Als Untersaat wurde eine fertige Blütenmischung „Sommerpracht“ von Bingenheimer verwendet sowie eine eigene Mischung aus Dill, Koriander, Kümmel, Drachenkopf, Tagetes, Roter Lein und Steinkraut. Geprüft wurden die Auswirkungen auf die Pflanzenentwicklung und die Erträge bei Blockpaprika sowie das Auftreten von Schädlingen.
Mit welchen einfachen Methoden kann im ungeheizten Folientunnel eine Ernteverfrühung bei Spitzpaprika erreicht werden? Spitzpaprika erfreut sich dank der aromatischen Früchte zunehmender Beliebtheit, aber es gelingt nicht immer, die Erträge frühzeitig auf dem Markt anbieten zu können. Daher wurde nun im zweiten Jahr der Versuchsreihe an zwei Sorten Spitzpaprika der Einsatz von Lochfolie und Mypexgewebe in unterschiedlichen Varianten erprobt und ausgewertet. Geprüft wurden die Erträge und die Reaktion der Pflanzen auf die Verfrühungsmaßnahmen.

Anmeldung für die Vorträge am 19.02.2025, 16:30 Uhr: Ökologische Freiland- und Unter Glas-Versuche
Hier geht es zur Online-Anmeldung (Anmeldeschluss 14. Februar 2025):
Vorträge am 26.02.2025:
Erdeloser Anbau von Tomaten, Melonen, Salat und Ingwer
Der Versuch hatte das Ziel die Sorteneignung von Melonen mit weniger als 2 kg Fruchtgewicht für den hydroponischen Anbau im Rinnensystem zu prüfen. Anbauziel ist dabei eine Versorgung des Marktes mit bayerischen Wassermelonen vor der Marktreife der Freilandmelonen. Weiterhin wurde untersucht, ob mit veredelten Jungpflanzen im Hinblick auf Pflanzenertrag und Pflanzengesundheit im Vergleich zu einer unveredelten Variante positive Effekte erzielt werden können.
Hydroponischer Ingwer wird seit 3 Jahren versuchsweise in Bamberg angebaut. Im ersten Jahr 2021 wurde generell die Eignung für diese Anbauform (DWC) geprüft. Ein Düngungsrezept wurde im zweiten Jahr entwickelt. Im vergangenen Jahr wurde mit der Verwendung von wieder verwendbaren Erntekisten eine neues Kulturverfahren sowie verschiedene Substrate getestet. 2024 wurde Perlit/Holzfasersubstrat (Fa. Kleeschulte), ein Kokossubstrat (Fa. van der Knaap) sowie Liaflor (Liapor GmbH & Co. KG), ein regionales mineralisches Substrat, auf Eignung geprüft.
Dazu wurde ein Versuch mit vier Fleischtomatensorten angelegt. Für den Versuchsaufbau standen zwei Bewässerungskreisläufe zur Verfügung. Das ermöglichte einen Kreislauf reduziert zu bewässern und zu düngen und diesen mit den Ergebnissen einer Standarddüngevariante zu vergleichen. Neben eines Sortenvergleiches war das wichtigste Versuchsziel eine Vorhersage der Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Calziummangel, das heißt die Gefahr des Auftretens von Blütenendfäule an den Früchten. Eine zeitweise Calziumunterversorgung in der Praxis tritt bei hohen Verdunstungsraten verbunden mit einem zu niedrigem Wurzeldruck insbesondere zu Beginn des Sommers, wenn die Tage lang und heiß sind, auf. Die Pflanze kann nicht genug Wasser in die Früchte transportieren. Dies stellt die Ursache für die Blütenendfäule dar. Der Anbauer kann der Blütenendfäule durch Düngung und Drosselung des Wachstums mittels Senkung der Verdunstungsrate durch Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, Temperaturabsenkung, Schattierung und Senkung des EC s in den Matte vorbeugen.
Der geschützte Anbau von Salatkulturen in Bayern steigt kontinuierlich. Allerdings verlangt dieser Anbau optimale Anbaubedingungen sowie ein ständiges sorgfältiges Monitoring mit dem Ziel einer Schadensvorbeugung. Durch die Größen der Anbauflächen gestaltet sich das Monitoring, also die manuelle Sichtung auf z.B. Schadbefall bzw. eine Düngeoptimierung sehr zeit- und personalaufwändig. In einem so bundesweit einmaligen Pilotprojekt prüfte die LWG in Bamberg den Einsatz von autonom fliegenden Drohnen zur frühzeitigen Erkennung und Validierung von Schädlingen und Krankheiten, sowie die Erfassung von Wachstumsparameter mit dem Ziel einer zuverlässigen Ertragsprognose. Dazu wurde in einem Folienhaus auf rund 25 m² Salat im Hydroponik-Verfahren angebaut.

Anmeldung für die Vorträge am 26.02.2025, 16:30 Uhr: Erdeloser Anbau von Tomaten, Melonen, Salat und Ingwer
Hier geht es zur Online-Anmeldung (Anmeldeschluss 21. Februar 2025):