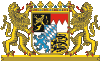Veranstaltungsbericht
Veitshöchheimer Obstbautag 2025

Am 23. Januar 2025 richtete die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) den Obstbautag in Veitshöchheim aus. Dort informierten sich Berater, Obstbauern und Interessierte über aktuelle Themen des Obstbaus. Die Hybrid-Veranstaltung war mit etwa 70 Personen vor Ort und 25 Onlineteilnehmer gut besucht.
Zu Beginn der Veranstaltung gab Karl-Ludwig Rostock, Präsident des Bayerischen Erwerbsobstbau-Verbandes e.V., einen Überblick über die aktuelle Verbandsarbeit. Dazu zählt die politische Interessenvertretung, insbesondere der Einsatz gegen eine Erhöhung des Mindestlohns für den Erhalt der Agrardieselbeihilfe und für eine Drittstaatenregelung bei Saisonarbeitskräften. Die Branche steht im internationalen Wettbewerb unter Druck, insbesondere durch Billigimporte aus südlichen Ländern. Da die derzeitige politische Lage keine Planungssicherheit bietet, rät der Verband derzeit von einer deutlichen Ausweitung der Produktion ab.
Asiatische Hornisse - Verbreitung in Bayern - Ist der Obstbau betroffen?
Dr. Stefan Berg warnte in seinem Vortrag vor der invasiven Asiatischen Hornisse, die sich bislang vor allem in Spanien und Frankreich ausgebreitet hat, inzwischen aber auch in Deutschland angekommen ist. Zuerst ist die Verbreitung entlang von Flüssen wie Rhein und Main verlaufen. Die Tiere sind aber zunehmend auch in Flächenlagen zu finden. Eine weitere und flächendeckende Ausbreitung ist sehr wahrscheinlich. Ihre Völker bestehen aus 6.000 bis 12.000 Individuen und bauen ihre Nester meist hoch oben in Bäumen. Sie ernähren sich unter anderem von Honigbienen und können pro Volk 11 bis 20 kg Insekten verzehren. Neben dem Bestäuberverlust verursacht die Hornisse auch direkte Schäden am Obst und hat in Spanien bereits zu Ernteausfällen im Wert von 4,5 Millionen Euro geführt. Zusätzlich zu schmerzhaften Stichen kann sie ihr Gift gezielt auf Feinde spritzen, was zu stunden- bis tagelangem Brennen in den Augen führt. Die Asiatische Hornisse ist an ihrem schwarzen Körper zu erkennen. Funde sollten gemeldet werden.
Frostschutzversuche im Obstbau
Am Nachmittag berichtete Alexander Zimmermann über verschiedene Frostschutzmaßnahmen, die in Versuchen getestet wurden. Mobile und stationäre Gasheizgeräte, die Temperatur und Luftfeuchte in den Anlagen erhöhen sollen, deckten jedoch nur die Hälfte der vom Hersteller angegebenen Fläche ab und erzielten in kalten Nächten keine ausreichende Schutzwirkung. Ein alternativer Ansatz waren mobile Nebelgeräte, die Wasserdampf erzeugen, um die vom Boden abgegebene Wärme in der Anlage zu halten. Jedoch wird bereits bei leichtem Wind der Nebel aus der Anlage getragen, sodass eine Schutzwirkung auch im Frostjahr 2024 nicht erzielt werden konnte. Die mit Holzbriketts betriebenen Frostöfen waren zwar effektiv, erforderten jedoch ein manuelles Nachlegen bei Nacht, was mit hohem Arbeitsaufwand verbunden ist. Zudem erschweren die hohe Temperatur und die Rauchentwicklung das Nachlegen. Auch mobile Windräder mit zu schwacher Motorleistung scheinen nicht effektiv genug zu sein. Gute Erfahrungen gibt es aber bei stationären Windmaschinen zum einen bei Betrieben in Franken, aber auch im Versuchsbetrieb Haidegg in der Steiermark. Die besten Ergebnisse wurden mit Frostberegnungsanlagen erzielt, die zudem die geringsten Betriebskosten aufweisen.
Windräder zur Spätfrostbekämpfung
Anschließend stellte Jan Bosmanns von der Firma Ghent-Supply die Frostschutz-Windräder der Firma „Orchard-Rite“ vor. Die in den USA gefertigten Windräder werden schon zu Tausenden in den USA sowie Frankreich und Spanien in verschiedenen Kulturen eingesetzt. Jährlich werden etwa 1.800 Windräder gebaut. Die Höhe der stationären Maschinen liegt bei knapp elf Meter und der Motor hat eine Leistung von 210 PS. Besonders betonte er, dass ihre Produkte kaum Wartungsaufwand erfordern.
Obstsorten für Direktvermarkter
Enikö Barakonyi präsentierte für die Firma Artevos Obstsorten für Direktvermarkter. Sie erläuterte die besonderen Eigenschaften ihrer Sorten, darunter verschiedene Krankheitsresistenzen, Reifezeiten, Geschmacksprofile und Wuchsformen. Zudem legte sie Wert auf das optische Erscheinungsbild der Früchte, da dieses eine wichtige Rolle für die Aufmerksamkeit der Kunden spielt. In den Pausen konnten einige vorgestellte Apfelsorten verkostetet werden.
Anbau- und Sortenversuche mit Heidel- und Erdbeeren im ökologischen Landbau
Die beiden letzten Vorträge widmeten sich Forschungsprojekten der LWG. Zunächst wurden die Ergebnisse der Erdbeer-Sortenversuche vorgestellt, bei denen Erträge, Geschmack, Optik der Früchte und marktfähige Anteile verglichen wurden. Anschließend wurde ein Versuch zum Anbau von Heidelbeeren in Dammkultur mit torfreduziertem Substrat präsentiert. Besonders gute Ergebnisse erzielten überdachte Varianten, insbesondere solche mit zusätzlicher Mykorrhiza-Behandlung. Die Sorte 'Reka' erwies sich als besonders gesund und wies den geringsten Befall mit dem Pilz Godronia auf.
Cidre aus heimischen Äpfeln
Zum Abschluss des Tages gab Annette Wagner einen Überblick über die Herstellung verschiedener Apfelweine, die von den Teilnehmern verkostet werden konnten. Sie erläuterte, wie Inhaltsstoffe der Äpfel wie Polyphenole, Säuren, Zucker und Mineralstoffe Geschmack, Farbe und Qualität des Weins beeinflussen.