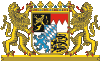Forschungs- und Innovationsprojekt
Innovative Methoden zur ökologischen Beikrautregulierung im Gartenbau

Die effiziente Regulierung von Beikräutern stellt eine wichtige Kulturmaßnahme dar, um ein ungestörtes Wachstum der Kulturpflanzen zu gewährleisten und somit hohe Erträge zu sichern. Zunehmende Einschränkungen des Herbizideinsatzes, ein Mangel an Saisonarbeitskräften und steigende Löhne stellen viele Anbauende vor die Frage, wie in Zukunft eine effektive Beikrautregulierung im Gartenbau gestaltet werden kann. Im Rahmen des Forschungsprojekts „Innovative Methoden zur ökologischen Beikrautregulierung im Gartenbau“ testete die LWG daher verschiedene Hackroboter und Mulchmaterialien in unterschiedlichen Gartenbaukulturen.
Ziel des Projektes
Um den Anbauern auch zukünftig ein wirtschaftliches Arbeiten zu ermöglichen, das mit den Aspekten des Umweltschutzes übereinstimmt und somit auch die Belange der Bevölkerung erfüllt, wurden in diesem Projekt verschiedene Möglichkeiten zum alternativen Beikrautmanagement untersucht. Dabei stand neben der Effizienz auch die Wirtschaftlichkeit im Fokus. Ziel des Projekts war es, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren und die Stärken und Schwächen verschiedener Alternativen zu bewerten. Einige autonome Systeme und Mulchmaterialien wurden dazu erprobt. Die Erkenntnisse der Versuche sollen der Information und der Empfehlung an die Praxis dienen und bei der Anschaffung neuer Geräte unterstützen.
Es wurden die Roboter „Farming GT“ (Farming Revolution), „FD20“ (FarmDroid) und „Dino“ (Naio Technologies) in verschiedenen Gemüsekulturen erprobt und bewertet. Der Roboter „Oz“ (Naio Technologies) war in einer Obstbaumschule im Einsatz. Die Maschinen basierten auf unterschiedlichen Techniken der Navigation, Pflanzenerkennung oder Antriebsart. Zudem wurden verschiedene Mulchabdeckungen bei Apfel und Himbeere auf ihre Beikrautunterdrückung untersucht.
Ergebnisse des Projekts
Hackroboter
Grundsätzlich sind alle erprobten Hackroboter in der Lage, unter optimalen Bedingungen gute Hackergebnisse zu erzielen und mit der konventionellen Hacktechnik technisch mitzuhalten. Allerdings war der Einsatz der Maschinen bisher nicht zuverlässig möglich. Zusätzlich sollten einige Voraussetzungen der Feldbeschaffenheit erfüllt sein, sodass die Roboter zufriedenstellende Hackergebnisse liefern können. Im Projektzeitraum konnten bereits einige technische Überarbeitungen eingepflegt werden, die zu einer Verbesserung der Geräte geführt haben. Diese Weiterentwicklungen wird es auch zukünftig benötigen, um die Hackroboter zuverlässig arbeiten zu lassen. Aufgrund der kompakten Abmessungen des Roboters „Oz“ war im Obstbaumschulversuch die Reduzierung der Reihenabstände auf 90 cm möglich. Im Versuch hat die Engpflanzung zu keinen Nachteilen hinsichtlich der Baumqualitäten geführt.
Derzeit sind die Hackroboter im Gartenbau wirtschaftlich nicht allgemeingültig rentabel einsetzbar. Dies liegt unter anderem daran, dass nicht alle Roboter vollständig zuverlässig arbeiten und aktuell mit viel Arbeitszeit für Fehlerbehebungen kalkuliert werden muss. Zudem sind die Anschaffungspreise der Geräte hoch. Gegenwärtig gibt es in Bayern eine Förderung in Höhe von 40 % (BaySL Digital), welche die Anschaffung schneller rentabel macht. Der Roboter sollte möglichst gut in den Betriebsablauf integriert werden. Andersrum sollten sich die entwickelten Agrarroboter möglichst leicht in die bestehenden Pflanzenbausysteme integrieren können, um den Anwendern den Einstieg in die Robotik zu vereinfachen. Für Betriebe mit kleinen Schlaggrößen ist der logistische Aufwand des Robotertransports ein erheblicher wirtschaftlicher Nachteil. Ob sich eine Investition in einen Roboter lohnen kann, hängt aber auch von einigen weiteren Faktoren ab, wie beispielsweise das Kultursortiment des Betriebs oder weitere Anwendungsbereiche für den Roboter. Entsprechend kann die Rentabilität betriebsindividuell sehr unterschiedlich ausfallen.
Da die neuen Technologien noch in der Entwicklung sind, benötigt der Anwender neben der Technikaffinität auch die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, sich schnell in neue technische Überarbeitungen einzulernen. Kreative Lösungen, die Anbauverfahren des Betriebs auf den Roboter anzupassen, könnten weitere Möglichkeiten bieten, um die Rentabilität der Systeme zu steigern – siehe Ertragssteigerung mit dem Roboter „Oz“ infolge der Engpflanzung in der Obstbaumschule. Einen weiteren Kostenfaktor stellen technische „Kinderkrankheiten“ dar. Teilweise konnten Roboter störungsbedingt nicht in einer zuverlässigen Weise eingesetzt werden. Anwender sollten frustrationstolerant sein und Alternativlösungen parat haben.
Ein wichtiger Treiber für die Investition in einen Hackroboter ist der Mangel an Saisonarbeitskräften. Aktuell sollte der Einsatz des Hackroboters allerdings auch immer mit dem Einsatz von Handhackkräften kombiniert werden, da die Hackergebnisse nur dann ausreichend gut sind. Rechtliche Rahmenbedingungen und die Haftungsfrage sollten für eine Etablierung der Systeme geklärt werden. Im Bereich des Gartenbaus besteht die Herausforderung, dass die Anbausysteme der unterschiedlichen Kulturen mitunter sehr variabel gestaltet sein können und häufige Anpassungen der Geräte oder gar Veränderungen der Anbauverfahren eine Hürde für die Etablierung der Hackroboter im Gemüse- und Obstbau darstellen. Letztendlich sollte ein geschulter Mitarbeiter für die Betreuung des autonomen Geräts eingeplant werden, um eine zügige Logistik (Transport, Batterieladen) zu gewährleisten.
Mulchmaterialien in Apfel und Himbeere
Da in einigen Kulturen die Beikrautregulierung durch Hacktechnik nicht möglich ist, sollten auch innovative Mulchabdeckungen getestet werden. Aktuell wird die Beikrautregulierung in diesen Kulturen häufig mit Herbiziden oder mechanischer Beikrautbearbeitung durchgeführt.
Im zweiten Teil des Projekts wurde daher die Wirkung von Mulchmaterialien, Lebendmulchen sowie verschiedenen Geweben zur Abdeckung getestet. Der Fokus lag auf der beikrautunterdrückenden Wirkung sowie der Verringerung der Evaporation durch die Materialien.
Im dreijährigen Versuch in einer Apfeljunganlage (Sorten 'Tramin' und 'Gräfin Goldach') mit verschiedenen Schüttgütern sowie Untersaaten, zeigte sich eine positive Wirkung bei der Beikrautunterdrückung wie auch dem Verdunstungsschutz bei den Varianten Miscanthusmulch und Holzhackschnitzeln. Untersaaten stellten am Standort in Thüngersheim mit eher sandigen Böden eine hohe Wasserkonkurrenz zu den Bäumen dar. Der Versuch musste nach dem dritten Jahr durch starke Beschädigungen von Mäusen gerodet werden.
Im einjährigen Versuch bei Apfel (Sorte 'Topaz') mit spritzbarem Mulchmaterial und Biozement zeigte sich eine positive Wirkung aller Varianten im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle bis Juni. In der zweiten Jahreshälfte konnte vor allem das mit 5 l/m² dick ausgebrachte spritzbare Mulchmaterial überzeugen. Es zeigte sich, dass das spritzbare Mulchmaterial in 5 l/m² Schichtdicke ausgebracht auf unbearbeiteten Boden deutlich dazu beitragen konnte, dass die Feuchte im Boden gehalten wurde.
Bei den Himbeeren gepflanzt auf Dämmen, die mit verschiedenen Materialien abgedeckt wurden, mussten einige Materialien (Schafwollmatten und Mulchpapiere) durch die schnelle Abbaurate innerhalb eines Jahres oder weniger als ungeeignet eingestuft werden. Auch die Untersaaten, Stroh und der Sprühmulch waren nicht für die Anwendung am Damm geeignet. Drei Materialien (Bändchengewebe, Ökolys, BioCovers) konnten auch im dritten Jahr noch überzeugen. Bei diesen Materialien war auch der Zuwachs statistisch signifikant besser als bei der Kontrolle.
Abschlussfazit
Zusammengefasst gibt es einige innovative Methoden zur herbizidfreien Beikrautregulierung mit vielversprechenden Aussichten. Bekannte und neuere Mulchverfahren zeigten eine beikrautunterdrückende Wirkung und die autonomen Technologien waren dazu in der Lage, bei passenden Bedingungen gute Hackergebnisse zwischen und in den Kulturreihen zu erzielen. Dennoch stehen einige der getesteten innovativen Verfahren noch am Anfang ihrer Entwicklung in den gärtnerischen Kulturen und sollten in Zukunft noch weiter überarbeitet werden.
Zum Vorgängerprojekt:
Weitere Informationen:
Projektinformationen
Projektleitung: Stefan Kirchner (LWG-IEF 1)
Projektbearbeiterinnen: Leonie Seehafer (LWG-IEF 1), Annika Killer (LWG-IEF 4)
Laufzeit: 01.12.2021 bis 28.02.2025
Finanzierung: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Förderkennzeichen: A/21/09