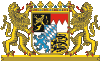Forschungs- und Innovationsprojekt
Bekämpfungsmöglichkeiten der Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) im bayerischen Weinbau
Untersuchungen zur Biologie des invasiven Schädlings Kirschessigfliege Drosophila suzukii im bayerischen Wein- und Obstbau unter besonderer Berücksichtigung sich daraus ergebender Regulierungs- und Bekämpfungsmöglichkeiten für die Praxis
Im Jahr 2011 ist die „Fliege mit der Säge“ durch importierte befallene Früchte in Bayern angekommen. Seitdem sägt und frisst sie sich durch das bayerische Wein- und Obstanbaugebiet – mit teilweise verheerenden Konsequenzen. Denn im Gegensatz zu unseren heimischen Essigfliegen, die ausschließlich vorgeschädigte und faulende Früchte zur Eiablage aufsuchen, befällt die Kirschessigfliege gesunde Früchte, die kurz vor Erntereife stehen.
2008 zum ersten Mal in Europa (Spanien) nachgewiesen, in den folgenden Jahren schnelle Ausbreitung
2009 in Norditalien (Trentino) gesichtet, im Jahr 2010 bereits 30 bis 40 Prozent Ertragsverlust im Obst- und Weinbau im Trentino
2010 in Südfrankreich, Slowenien und Kroatien nachweisbar
2011 anlageweise Totalausfälle an Beerenobst in Italien, sowie an Kirschen in Spanien und Südfrankreich. Ende 2011 Nachweis in Nordfrankreich, in der Schweiz und in Süddeutschland
2012 erste Sichtung in Franken
2013 bayernweit nachgewiesen, ohne dass Schäden bekannt wurden
2014 erstmals große Population in Bayern etabliert mit erheblichen Schäden im Wein-, Obst- und Gartenbau

Kirschessigfliege oben Männchen, unten Weibchen
Die Suche nach alternativen Bekämpfungsmöglichkeiten nimmt daher in der Kirschessigfliegen-Forschung einen großen Raum ein. Anforderungen an alternative Methoden sind die Verhinderung bzw. effektive Absenkung der Eiablageaktivität, die Nicht-Beeinträchtigung von Nützlingen sowie die Unbedenklichkeit des Einsatzes nahe dem Erntezeitpunkt.
Generell sind zur Biologie der Kirschessigfliege noch viele Fragen offen. Zu Überwinterungsstadien und -orten gibt es verschiedene Aussagen. Die Lebensweise und Ernährung im zeitigen Frühjahr bis zum Aufsuchen der ersten Obstarten (Erdbeere, Kirsche) ist weitgehend unklar, ebenso die Ursachen für das beobachtete plötzliche Ansteigen der Fangzahlen im Sommer. Die hohe Anzahl möglicher Generationen über eine Sommersaison (bei 25° C ca. 14-tägiges Generationsintervall) sowie das weite Spektrum wilder und kultivierter Wirtspflanzen erschweren die Regulierung und Bekämpfung. Sie bedingen bei chemischen Pflanzenschutzmaßnahmen ein erhöhtes Resistenzpotenzial. Die notwendigerweise erntenahen Behandlungen sind aufgrund der Wartezeiten mit herkömmlichen Pflanzenschutzmitteln nur erschwert umsetzbar. Daher besteht Bedarf an Pflanzenschutzmitteln mit kürzerer Wartezeit.
Hinsichtlich des Bienenschutzes sind das Gefährdungspotenzial und mögliche Expositionswege für Bienenvölker nicht hinlänglich geklärt. Dies gilt sowohl für den Praxiseinsatz von Insektiziden als auch für andere Bekämpfungsmaßnahmen wie zum Beispiel Fraßköder oder Insektenleime in Obst- und Rebanlagen mit Kirschessigfliegenbefall.
Ziel des Projektes
Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs mit Bekämpfungs- und Regulierungsmöglichkeiten, die die Winzer schnell und ohne aufwändige „Mehrarbeit“ in die weinbauliche Praxis übernehmen können. Idealerweise wäre ein effektives Vergrämungsmittel gegen die Kirschessigfliege zu finden, dass nachhaltig, nützlingsschonend und unbedenklich bis zur Ernte eingesetzt werden kann und die Traubenreife und Weinbereitung nicht beeinflusst.
Methoden des Projektes
Unter anderem werden im Labor an einer Zuchtpopulation der Kirschessigfliege Experimente durchgeführt, dazu gehören Wirksamkeitsstudien, Verhaltenstests und chemisch-mikrobiologische Untersuchungen. Auf den Laborergebnissen basieren praxisnahe Freilandversuche im Weinbau und Gartenbau. Diese erlauben es, die Umsetzbarkeit der untersuchten Maßnahmen für den Praktiker (also Winzer und Obstproduzenten) zu bewerten.
Die Flugaktivität der Kirschessigfliege wird während des ganzen Jahres mittels Essigfallen überwacht und das Monitoring vor und während der Vermehrungsphase im Sommer intensiviert. Um die Eiablagen in Weintrauben zur erfassen, werden reifende und reife Beeren verschiedener Rebsorten aus gefährdeten Lagen und Vergleichslagen untersucht, um entsprechende Hinweise zu Gegenmaßnahmen an die Praxis geben zu können. Die Daten dazu werden regelmäßig im Internet aktualisiert und Warnhinweise im "Weinbaufax Franken" veröffentlicht.
Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln muss zeitlich genau auf das tatsächliche Auftreten von Kirschessigfliegen abgestimmt sein. Den korrekten Zeitpunkt kann man durch Monitoring der lokalen Population und der beginnenden Eiablage feststellen.
Bereits zugelassene und mögliche neue Pflanzenschutzmittel verschiedener Wirkstoffklassen werden zunächst unter Laborbedingungen bezüglich ihrer Wirksamkeit auf ausgewachsene Fliegen, in Früchten abgelegte Eier und sich entwickelnde Larven verglichen. Geeignete Substanzen werden anschließend im Freilandversuch unter Praxisbedingungen weiter geprüft.
Ergänzend werden kulturtechnische Maßnahmen auf ihre Auswirkung auf den Befall mit Kirschessigfliegen getestet.
Ein Hauptaugenmerk liegt auf der Suche nach nachhaltigen Alternativen zu den zugelassen Pflanzenschutzmitteln, die auch im ökologischen Weinbau eingesetzt werden können.
Dazu werden in Labor- und Halbfreilandversuchen Vergrämungsmittel gegen die Kirschessigfliege getestet. Mittel, die sich im Laborversuch als effektiv erweisen, werden im Freiland während der Traubenreife auf einer Versuchsfläche (bestockt mit der Rebsorte Cabernet Dorsa) eingesetzt und die Vergrämungswirkung dokumentiert.
Zusätzlich werden hinsichtlich des Bienenschutzes das Gefährdungspotenzial und mögliche Expositionswege für Bienenvölker beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Weinbau in Kooperation mit dem Institut für Bienenkunde und Imkerei der LWG untersucht.
Ergebnisse des Projektes
Monitoring der Kirschessigfliege
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Falle zur Überwachung der Kirschessigfliege
Gegenmaßnahmen gegen die Kirschessigfliege
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Tonerde Kaolin
Bei alternativen Behandlungsstoffen zeigte die Tonerde Kaolin sehr gute Effekte. Diese Tonerde wäre auch im ökologischen Weinbau einsetzbar. Ein Nachteil von Kaolin ist der weithin sichtbare weiße Spritzbelag auf den Trauben und Blättern. Daher wird empfohlen bei Kaolineinsatz ein Hinweisschild an den Weinberg anzubringen, damit Passanten sich über diese alternative Methode informieren können.
Die Suche nach vergrämenden Stoffen, den sogenannten Repellents, verlief trotz sehr umfangreicher Ansätze leider nicht sehr erfolgreich. Die meisten getesteten Substanzen hatten keine vergrämende Wirkung auf die Kirschessigfliege. Einzige Ausnahme war Knoblauch als ätherisches Öl, das jedoch aufgrund der starken geruchlichen Wahrnehmung nicht im Freiland eingesetzt werden konnte.
Natürliche Feinde der Kirschessigfliege
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Die Erzwespe (Pachycrepoideus vindemmiae)
Unter den in Unterfranken heimischen Parasitoiden konnte bereits eine Art identifiziert werden, die auch Puppen der Kirschessigfliege als Wirt nutzt. Wie häufig dies vorkommt und ob diese Art zur biologischen Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden könnte, ist aber noch nicht bekannt.
Einfluss der Bekämpfung auf Honigbienen
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Biene an Futterspritze in Reben
Die mögliche Gefährdung von Honigbienen durch verschiedene Behandlungsmethoden gegen die Kirschessigfliege im Weinbau wird in Kooperation mit dem LWG-eigenen Fachzentrum Bienen bearbeitet. Die komplexen Ergebnisse sind im Forschungsbericht Phase 1 zusammengestellt.
Sortenempfindlichkeit bei Reben

Teilweise wurden auch Eiablagen in überreifen oder verletzten Beeren von grün färbenden Weißweinsorten (Scheurebe, Bacchus, Müller-Thurgau) festgestellt. In einem nicht überreifen Reifezustand und bei unverletzten Beeren wurde bei grünfärbenden Weißweinsorten allerdings keine Eiablage beobachtet. Dies bestätigen auch die Rückmeldungen aus der Praxis

Die chemische Analytik der mit Kirschessigfliegen befallenen Moste wies keine erhöhten Werte negativer Substanzen (wie z. B. flüchtige Säure) auf.
Publikationen
- Wurdack, M.(2019): Kirschessigfliege mit schwerem Gerät - Legebohrer durch Metallionen gehärtet. Das deutsche Weinmagazin 13/2019 24ff
- Wende, B. (2018): Klimawandel im Weinbau – Wohlfühlatmosphäre für die Kirschessigfliege (Drosophila suzukii)? Schule und Beratung 08/2018
- Wende, B. (2018): Die Kirschessigfliege in Bayern – gekommen, um zu bleiben. Rebe & Wein 7/2018: 26-28
- Hönig, P. & Wende, B. (2017): Biologie der Kirschessigfliege – „Nur gegen einen Schädling, den man kennt, kann man wirkungsvoll etwas tun“. Informationsbroschüre für Winzer. LWG Veitshöchheim; 2. überarbeitete Auflage
- Wurdack, M. & Wöppel, H.-J. (2016): Die Kirschessigfliege im Visier – Fränkische Rebschutzwarte schauen genau hin! Rebe & Wein 5/2016: 30-31
- Wurdack, M. (2016): Einfluss der Begrünung. Rebe & Wein 3/2016: 23-24
- Wurdack, M. (2015): Die Kirschessigfliege ist ein Feinschmecker. Rebe & Wein 11/2015: 20-21
- Hönig, P. (2015): Biologie der Kirschessigfliege – Nur gegen einen Schädling, den man kennt, kann man wirkungsvoll etwas tun. Rebe & Wein 4/2015
- Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (2015): Die Kirschessigfliege im Haus- und Kleingarten. Informationsbroschüre für die Kunden der Gartenakademie der LWG Veitshöchheim
- Hönig, P. (2014 vor Projektstart): Die Kirschessigfliege Drosophila suzukii – eine Neozoe; Schule und Beratung 8-9 / 2014
Projektinformation
Projektleitung: Hans-Jürgen Wöppel
Projektbearbeiter: Mareike Wurdack (5/2015 bis 2/2017), Dr. Beate Wende (ab 3/2017), Sina Werner und Sonja Heinkel
Laufzeit: 01.05.2015 bis 31.12.2020
Finanzierung: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF)
Förderkennzeichen:A/15/11 (05/2015-12/2017); A/18/03 (01/2018-12/2020)
Dieses Projekt dient der Umsetzung des Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz (NAP)