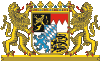Förderung der Biodiversität – Maßnahmen

Weinbau 2025/2050 – Modellweinlage zur Förderung der Artenvielfalt
Am Thüngersheimer Scharlachberg besitzt die LWG ca. 10 Hektar Rebfläche. Die teilweise sehr steile und nach Süden ausgerichtete Weinlage bietet perfekte Ausgangsbedingungen, um die Effekte des Klimawandels auf den fränkischen Weinbau zu untersuchen. Gleichzeitig erhöht eine große Lebensraum- und Artenvielfalt die Widerstandsfähigkeit des Ökosystems gegenüber sich verändernden Umweltbedingungen. Daher wird am Scharlachberg ebenfalls untersucht, wie die Biodiversität in der Weinkulturlandschaft bestmöglich gefördert werden kann, ohne die Wirtschaftlichkeit der Rebflächen zu beeinträchtigen. Im Vergleich zu früheren Arbeiten wird nicht mehr nur der einzelne Weinberg betrachtet, sondern die Gesamtheit der Weinberge in einer Weinlage sowie deren natürliches Umfeld. Saumstrukturen binden die Weinberge in die Landschaft ein und sind gleichzeitig die verbindenden Strukturen für den Austausch und die Wanderung vieler Arten. So ist die Verknüpfung der einzelnen Maßnahmen wie z. B. das Einrichten von Blühstreifen, über mehrere Weinberge und wenn möglich die Anbindung an natürliche Trocken- bzw. Magerrasenflächen ein wesentlicher Bestandteil der biodiversitätsfördernden Maßnahmen.
Die verschiedenen Maßnahmen werden nachfolgend ausführlich dargestellt. Besucher sind in der Weinlage Thüngersheimer Scharlachberg jederzeit willkommen. Für Weinbauvereine bietet das Institut für Weinbau und Oenologie der LWG Führungen durch die Weinlage an.
Blühende Wegraine, Blühstreifen
Wegraine, Randstreifen, Wegsäume – diese Flächen bieten bei der richtigen Pflege besondere und wertvollen Lebensräume für bis zu 1000 Pflanzen- und Tierarten. Entlang der Wege an den Randstreifen können sich Blühsäume ohne negativen Einfluss (wie z.B. Wasserkonkurrenz) auf die Reben entwickeln. Für Pflanzen und Tiere bilden Wegränder die eigentlichen „Wege“, da sie über die gesamte Weinlage Lebensräume miteinander vernetzen und auf diese Weise die Ausbreitung der Arten fördern. Um diese wichtige Funktion ausüben zu können, ist eine extensive Pflege der Wegränder nötig. Dies bedeutet, dass die Wegsäume maximal 1–2-mal im Jahr gemäht werden sollten. Bei sehr grasigen und wüchsigen Standorten ist eine zweimalige Mahd (Mitte Juni und Ende September) sinnvoll. Bei Mahd Ende September sollten abschnittsweise Rückzugsräume für den Winter belassen werden, da Insekten die verholzten und hohlen Stängel mehrjähriger Stauden (z.B. Wilde Möhre) als Überwinterungsquartier nutzen. Eine weitere Möglichkeit wertvolle Blüh- und Refugienflächen zu schaffen, ist die Umwandlung arbeitsintensiver Spitzzeilen.
Querterrassierung
Vielerorts prägen Weinbau-Steillagen das landwirtschaftliche Erscheinungsbild einer Region. Die extremen Produktionsbedingungen an diesen Standorten führen jedoch häufig zur Aufgabe dieser Steillagen. Durch die fehlende Bewirtschaftung verbuschen diese Flächen sehr schnell. Langfristig wird die Fläche von Heckenpflanzen und Bäume eingenommen. Jedoch sind viele der typischen Weinbergsbewohner auf warme, sonnenbeschienene Flächen mit nur spärlichem Bewuchs angewiesen. Bei Verbuschung und Beschattung ziehen sich die Arten sofort aus dem Lebensraum zurück. Dies bedeutet, dass bei Aufgabe von Steillagen und der damit verbundenen „Zuwucherung“ für viele der speziell angepassten Arten der Lebensraum zunehmend schrumpft.
Die am Standort Scharlachberg heutige Querterrassierung war vormals eine Direktzuganlage, die von einer Trockenmauer abgeschlossen und arbeitstechnisch nur schwer bewirtschaftbar war. Im September 2013 wurden 1,3 ha ehemalige Rebfläche zu Querterrassen mit rund 1,80 m Höhe und rund 2 m Breite umgestaltet. Zum Schutz vor Erosion wurden spezielle, an trockene Standorte angepasste Begrünungsmischungen aufgebracht. Der Böschungsfuß und der Wegbereich blieben weitestgehend offen. Bereits im ersten Sommer konnten zahlreiche Tierarten mit einer Vorliebe für trockene, heiße Standorte beobachtet werden. Der hier entstandene Biotopkomplex aus offenbodigen Geröllflächen neben schwach bewachsenen, trockenrasenähnlichen Standorten und ökologisch bewirtschafteten Rebzeilen erfüllte bereits in den ersten Sommern die Voraussetzungen an den Lebensraum für das Auftreten einer Vielzahl dieser wärmeliebenden Tiere.
Brache – Lebensraum auf Zeit
Mit der Entfernung einer alten Rebanlage ist bis zur Neuanpflanzung die einmalige Möglichkeit gegeben, ungehindert von Rebstöcken und Drahtrahmen ganzflächig gezielte Bodenpflege-maßnahmen zu ergreifen. Die Brachezeit bietet die besondere Chance, Störungen im Bodengefüge zu beheben und mit entsprechenden Lockerungs- und Begrünungs¬maßnahmen zu verbessern. Zur Verbesserung der Bodenstruktur ist es sinnvoll, artenreiche Begrünungs¬mischungen auf den Brachflächen einzusäen. Die verschiedenen Pflanzenarten mit ihren unterschiedlichen Wurzel-horizonten leisten wichtige Arbeit, um den Boden bis in tiefere Schichten zu durchwurzeln und aufzulockern. Der Nebeneffekt einer Brache ist, dass diese Fläche vorübergehend als „Öko-Nische“ dient, ein Ackerrandstreifeneffekt eintritt und das Landschaftsbild aufgelockert wird. Oberirdisch bietet die vielartige Begrünung Nahrung für viele verschiedene Insekten und Wildbienenarten. Aber auch Vögel, Rebhühner und andere Tiere finden in der Brachebegrünung Nahrung und Schutz. Im Sinne der Artenvielfalt ist die Pflege der Brachflächen allerdings differenzierter zu betrachten. So ist es wichtig, dass es neben den begrünten Flächen auch offene Bereiche gibt. So ernähren sich zum Beispiel viele Vogelarten der halboffenen Kulturlandschaft zu einem Großteil von Insekten und Spinnen am Boden. Auch im Boden nistende Wildbienen nutzen diese offenen Bodenflächen.
Stein-Lebensräume
Bereits in historischen Zeiten wurden in Franken Reben oft auf kargen, steinigen Böden in Hanglagen gepflanzt, die für sonstige landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet waren. Da zur Bewirtschaftung große Steine störten, wurden diese in unzähligen händischen Arbeitsstunden abgesammelt und auf den Flurstücksgrenzen abgelagert. So entstanden über Jahrhunderte die landschaftsbildprägenden Steinriegel und Steinschütten. Wärmeliebende Tier- und Pflanzenarten eroberten schnell die steinigen Lebensräume, die tagsüber in Spalten und Ritzen feuchte und kühle Verstecke bieten und nachts die gespeicherte Sonnenwärme wieder abgeben. Mittlerweile wird jedoch ein großer Teil dieser Arten auf der Roten Liste geführt, da die Steinlebensräume im Rahmen von Flurneuordnungen größtenteils verschwanden. Mittlerweile werden bei der mechanischen Bearbeitung von Rebanlagen oder bei Neuanlage eines Weinbergs freigelegte Steine oft entsorgt. Zur Förderung der Biodiversität sollten die Lesesteine zur Wiederanlage von Steinhaufen oder Steinschütten genutzt werden. Hierbei ist zu beachten, dass Lesesteinriegel als Landschaftselement gelten und ab Anlage unter Schutz stehen. Doch es muss nicht ein großer Steinriegel sein – mehrere kleine Steinhaufen erfüllen ebenfalls wichtige Lebensraumfunktionen.
Um die steilen Hänge für den Weinbau zu erschließen, wurden Trockenmauern als Stützen errichtet. Aufgrund ihrer Wasserdurchlässigkeit wurden ausschließlich unverfugte Naturmauern errichtet, da diese langlebiger und stabiler sind als verfugte Mauern. Niederschläge versickern langsam hinter den Trockenmauern im Boden. So können Pflanzenwurzeln im Boden das Niederschlagswasser allmählich aufnehmen, wodurch sich der Oberflächenabfluss verringert. Weiterhin kann durch die unverfugten Spalten überschüssiges Wasser ausgeleitet werden, ohne das Druck auf das Mauergestein ausgeübt wird und die Mauer dadurch langfristig Schaden nimmt.
Auch für die Biodiversität sind Trockenmauern wichtige Strukturen, da sie Tieren und Pflanzen viele verschiedene Lebensräume bieten. In und um Trockenmauern finden sich von der Sonne aufgeheizte oder schattige, sowie kühle, trockene und feuchte Plätze auf engsten Raum nebeneinander. Eine Vielzahl von Insekten, Spinnen, Schnecken, Reptilien, Amphibien finden in den unverfugten Spalten- und Ritzen von Trockenmauern ideale Rückzugs-, Jagd- und Überwinterungsmöglichkeiten. Und im Winter bieten Trockenmauern frostsichere Quartiere für die Überwinterung. Doch der Erhalt und die Pflege der Mauern sind sehr aufwändig.
Deshalb bietet die Staatsregierung über das bayerische KULAP-Programm eine Förderung zum Erhalt und Sanierung von Weinbergsmauern an (I86 – Wiederaufbau von Steinmauern in Weinbausteillagen), um diese landschaftsprägenden Strukturen und damit Lebensräume zu erhalten.
An die Weinlagen angrenzende Felsen sind Teil dieses trockenen, warmen Lebensraumes. Schnell wachsende Gehölze überwuchern innerhalb weniger Jahre diese Bereiche. Daher ist eine regelmäßige Pflege dieser Habitate notwendig. Mittels geschotterter statt geteerter Wege können steinige Lebensräume miteinander vernetzt werden.
Totholz als Lebensraum
Viele Insekten und weitere Tiere benötigen neben der Nahrung, die sie in den blühenden Begrünungen finden, auch Rückzugsräume zum Schutz vor Frost, Hitze, Trockenheit oder Nässe und vor Räubern; für die Aufzucht der Jungen wird häufig ein spezieller Lebensraum benötigt. Diese Aufgaben übernimmt oft das sogenannte Totholz. Totholz ist im Gegensatz zu seinem Namen sehr lebendig, denn hier finden sich unzählige Käferarten, Fliegen, Ameisen und vor allem Wildbienen und Wespen. Nachdem in den Weinbergen meist kein Totholz in Form von Holzstickeln mehr zu finden ist, fehlt dieses notwendige Angebot für Insekten. Abhilfe bietet das künstliche Angebot durch Totholzhaufen oder – für viele Arten wichtig – senkrecht stehendes Totholz. Daneben können spezifisch vorbereitete Nisthölzer dem Brutraummangel Abhilfe schaffen.
Weinberghütte
Früher waren Weinberghütten ein gängiges Element in der Weinkulturlandschaft. Dort wurden die Handwerksgeräte für die Arbeit im Weinberg untergebracht und die Hütten dienten als Unterschlupf bei schlechtem Wetter oder für die wohlverdiente Pause. Im Zuge der Flurbereinigungen verschwanden die Hütten aus den neu angelegten Weinbergen. Mit der zunehmenden Mechanisierung der Arbeit in den Weinbergen mit Schlepper und Anbaugeräten entfiel die Notwendigkeit eines Lagerraums für die Handgeräte.
In Weinberghütten fanden vor allem Schleiereulen und Fledermäuse Nistmöglichkeiten in den alten Dachstühlen. Nisthilfen an den Außenseiten noch bestehender Weinberghütten oder Scheunen ermöglichen Höhlenbrütern wie den Meisen oder Halbhöhlenbrütern wie dem Hausrotschwanz einen geeigneten Platz für die Aufzucht der Jungen.
Tipps - schnell und leicht gemacht
Hummeln im Weinberg
Wenn ein solches Nest bei der Boden¬bearbeitung auffällt, bewahrt das kurze Ausheben oder Ausmachen des Arbeitsgeräts vor der Zerstörung des Hummelvolkes. Um im weiteren Jahreslauf dieses Nest vor Störungen zu schützen, sollte die Stelle entsprechend markiert werden.
Die friedliche Erdhummel ist eine fleißige Bestäuberin, die vom frühen Frühjahr bis in den Herbst unterwegs ist.
Vielfalt durch gezieltes Nichtstun

Denken Sie daran, dass gerade in den Randstreifen sehr viele Arten beheimatet sind, die uns als Nützlinge zur Seite stehen.
- Lassen Sie einen Randstreifen zum Weg und, wo möglich, einen Blühstreifen in der Gassenmitte stehen.
- Die Ansaat einer teuren Blühmischung, die nicht zur Blüte kommen kann, weil sie zu früh gemäht oder gemulcht wird, ist sinnlos!
- Stellen Sie den Mulcher nicht zu niedrig (> 8 cm) ein. Dadurch wird eine „Mattenbildung“, die zu unerwünschtem Ersticken der Pflanzen und Fäulnis führen kann, vermieden. Außerdem wird die „Vergrasung“ reduziert, da höhere, krautige Pflanzen wieder nachtreiben können.
- Aufgrund der guten Durchfeuchtung des Bodens in solch einem Frühjahr ist die Ansaat von Blühmischungen noch gut möglich.
- Wählen Sie eine Ecke aus, die bei Mäh-/ Mulcharbeiten ausgelassen werden kann. Der Raum vom Endstickel bis zur Straße sollte weitgehend unbearbeitet bleiben.
- Ein zeitiges Abschalten der Boden¬bearbeitungs¬geräte hilft beim Aufbau eines breiten Randstreifens.
So kann sich mit der Zeit eine reichhaltige Lebens¬gemeinschaft mit vielerlei Pflanzen und Tieren ansiedeln. Wird dies von vielen Winzern einer Gemarkung durchgeführt, bildet sich mit den durch die gesamte Weinlage ziehenden blühenden Streifen eine Biotopvernetzung, die die Artenvielfalt fördert und die Kulturlandschaft aufwertet.
Ein negativer Einfluss auf die Reben ist nicht gegeben und das „Nichtstun“ bringt viele Vorteile:
- es entstehen Rückzugsorte für Nützlinge,
- das Landschaftsbild wird aufgelockert und bunt,
- die (wein)touristische Attraktivität wird erhöht,
- die Biodiversität durch viele verschiedenartige Pflanzen und damit auch Tiere gefördert und
- es zeigt der Gesellschaft die Bemühungen des Winzerstandes für die Umwelt.
- Zur Pflege dieser Begrünungen reicht ein einmaliger nicht zu kurzer Schnitt (> 8 cm) im Spätherbst aus.