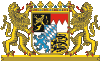Forschungs- und Innovationsprojekt
Biodiversität im Stadtgrün

Vergleichende Untersuchungen blütenbesuchender Insekten auf gebietseigenen und nichtheimischen Ansaatmischungen und deren Einfluss auf die Biodiversität von Stadtbäumen.
Der Artenrückgang und der Klimawandel sind zwei drängende Probleme, die in der derzeitigen Stadtentwicklung unbedingt berücksichtigt werden müssen. Durch den Verlust an natürlichen Lebensräumen außerhalb der Städte ziehen sich viele Tierarten in die urbanen Grünflächen zurück, doch auch hier muss das Grün immer weiter der starken Bebauung und Versieglung weichen. Bestäuber finden immer schwerer Nahrung und Nistplätze und ihre Zahlen sinken drastisch.
Auch die Auswirkungen des Klimawandels sind in Deutschland immer deutlicher zu spüren, denn Hitzewellen und Trockenperioden haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Eine Folge ist eine veränderte Entwicklung von Wildpflanzen, die immer früher blühen, sodass der phänologische Frühling heute zwei Wochen früher beginnt als noch vor einigen Jahrzehnten. Dies bedeutet gleichzeitig, dass viele heimische Pflanzen früher abblühen und im Spätsommer und Herbst nur noch ein geringes Angebot an Blüten für Bestäuber zur Verfügung steht. Diese Verschiebung zeigt sich vor allem in Städten, da hier durch die starke Bebauung und Versiegelung Wärmeinseln entstehen.
Pflanzenarten aus anderen Gebieten können besser an ein solches trocken-heißes Klima angepasst sein und so besser mit den extremer werdenden Bedingungen zurechtkommen als heimische Arten.
Zielsetzung
Ziel des Projektes war es, die Eignung gebietseigener und nicht-heimischer Wildpflanzenmischungen für Ansaaten im innerstädtischen Straßenbegleitgrün zu untersuchen, sowie ihre Eignung als Nahrungsquelle für Insekten zu bestimmen. In Städten kommen Wildpflanzenmischungen häufig als Untersaaten von Baumpflanzungen zum Einsatz, daher sollen auch die Wechselwirkungen zwischen den Ansaatflächen und darauf befindlichen Stadtbäumen untersucht werden.
Methodik
Die Untersuchungen fanden an drei unterschiedlich geschnittenen Untersuchungsflächen an Baumpflanzungen (Mongolische Linden und Silber-Linden) entlang von Straßen statt (siehe Lageplan).
Grundsätzlich müssen Ansaaten im Stadtgebiet unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Sie sollen pflegeleicht und optisch ansprechend sein und dürfen nicht zu hochwüchsig sein, um die Sichtachsen im Straßenverkehr nicht zu behindern. Zwei artenreiche, mehrjährige Wildpflanzenmischungen wurden im Februar 2021 angesät: Eine gebietseigene Mischung (Ursprungsgebiet Südwestdeutsches Bergland) und eine nicht-heimische Mischung mit Arten aus Nordamerika, Nordafrika und Eurasien. Bereits vorhandene Rasenflächen wurden belassen und dienen als Kontrollflächen. Die beschriebene nichtheimische Mischung wurde ausschließlich für den Versuch konzipiert, um die Wertigkeit nichtheimischer Wildpflanzen für heimische Wildbienen und Schwebfliegen zu untersuchen. Sie ist in der Form zunächst nicht für die Praxis gedacht, denn es gibt zahlreiche Insekten, die auf eine einzige oder ganz wenige heimische Pflanzenarten spezialisiert sind und ohne diese keine Lebensgrundlage haben.
In regelmäßigen Abständen wurden die Blütenvielfalt und optische Erscheinung der Mischungen bewertet. Außerdem wurden die Wildbienen und Schwebfliegen bestimmt, die die Blüten der Wildpflanzenmischungen, Rasenflächen und Stadtbäume besucht haben.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Lageplan des Untersuchungsgebietes
Ergebnisse
Beide Mischungen konnten sich gut etablieren und die Blüte begann bei beiden Mischungen Ende April. Auffällig war, dass die gebietseigene Mischung ihre Hauptblüte früher erreichte als die nicht-heimische, die vor allem im Hochsommer und Herbst ein hohes Blütenangebot zur Verfügung stellte. Außerdem war die gebietseigene Mischung anfälliger gegenüber langen Trockenphasen, während die nicht-heimische Mischung auch bei Trockenheit durchgängig Blüten entwickelte. Als besonders trockenheitsverträglich sind Centaurea jacea ssp. angustifolia aus der gebietseigenen Mischung und Antirrhinum braun-blanquetii, Hyssopus officinalis, Aster ericoides, Gaura lindheimeri sowie Verbena stricta aus der nicht-heimischen Mischung hervorzuheben.
Das Blütenangebot beeinflusste maßgeblich die optische Bewertung und damit die Akzeptanz in der Bevölkerung, sowie das Vorkommen von Wildbienen. So besuchten die Wildbienen die gebietseigene Mischung vor allem im Frühjahr, später dann die nicht-heimische Mischung. Insgesamt hat dadurch die nicht-heimische Mischung mehr Wildbienen angezogen als die gebietseigene Mischung. Dies galt auch für gefährdete und spezialisierte Wildbienen.
Bei den Schwebfliegen war kein Unterschied in der Akzeptanz von gebietseigener und nicht-heimischer Mischung zu entdecken. Generell gab es keine Wechselwirkungen mit den Bäumen.
Als besonders beliebte Pflanzenarten sind Centaurea jacea und Leucanthemum ircutianum aus der gebietseigenen Mischung sowie Nepeta racemosa und Hyssopus officinalis aus der nicht-heimischen Mischung hervorzuheben.
Fazit
Die Verschiebung der Blüte unter extremer Trockenheit und Hitze war bei der gebietseigenen Mischung deutlich zu sehen. Die entstandene Trachtlücke im Sommer und Herbst konnte durch die robusten Arten in der nicht-heimischen Mischung jedoch gefüllt werden.
So bietet es sich an, an Extremstandorten wie dem Straßenbegleitgrün eine Kombination aus gebietseigenen bzw. heimischen und nicht-heimischen Wildpflanzen einzusetzen, um das ganze Jahr über Blüten und damit Nahrung für Bestäuber zu gewährleisten. So können die gebietseigenen (bzw. heimischen) Arten vor allem im Frühjahr Nahrungsquellen schaffen und spezialisierten Insekten die Lebensgrundlage sichern, während nicht-heimische Arten vor allem im Sommer und Herbst, sowie in Zeiten extremer Hitze und Trockenheit das Blütenangebot aufrechterhalten können.
Rein nicht-heimische Mischungen sollten eher nicht eingesetzt werden, denn es ist stark davon auszugehen, dass solche Pflanzungen nicht allen heimischen Insekten ausreichend Nahrung liefern können. Einige Wildbienenarten oder Larvenstadien der Schmetterlinge sind in ihren Anpassungen an die Wirtspflanzen hoch spezialisiert, sodass das Angebot heimischer Pflanzen hierfür erforderlich ist.
Eine denkbare Mischung, die aus einem Verschnitt der beiden untersuchten Mischungen konzipiert wurde, ist in der folgenden Tabelle aufgeführt. Diese enthält ausschließlich Arten, die zuverlässig aufgewachsen sind, zur Blüte kamen und mit den gegebenen Standortbedingungen im Straßenbegleitgrün zurechtkommen. Es sind viele gebietseigene Wildpflanzen vertreten (Ursprungsgebiet Südwestdeutsche Bergland) und mit ausgewählten nicht-heimischen Wildpflanzen mit hoher Trockenheitstoleranz und später Blüte kombiniert. Die Mischung wurde so in ihrer Form noch nicht in der Praxis geprüft und soll hier nur als mögliches Beispiel dienen.
Ausgewählte Publikationen
Kooperationspartner
Das Projekt „Biodiversität im Stadtgrün“ wurde in Kooperation mit dem Gartenamt der Stadt Würzburg und dem Center for Applied Energy Research e.V. (CAE), Würzburg durchgeführt. Zusätzlich wurden Flächen von der Stadt Karlstadt zur Verfügung gestellt. Das Forschungsvorhaben erstreckte sich auf 3 Jahre.
Projektdaten:
Projektleitung: Jürgen Eppel
Projektbearbeiter: Dr. Elena Krimmer, Angelika Eppel-Hotz
Laufzeit: 01.07.2020 bis 31.12.2023
Finanzierung: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus
Förderkennzeichen: A/19/22