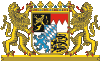Forschungs- und Innovationsprojekt
Sortenerhaltungskonzept Streuobst Bayern

Einst gab es in Bayern weit über 5.000 Obstsorten, Höhepunkt war Ende des 19. Jahrhunderts. Mit dem Niedergang des Streuobstbaus seit den 1960er Jahren, vor allem auf Grund des Wegfalls der Bedeutung für die Selbstversorgung der Bevölkerung ging nicht nur der Verlust vieler Obstsorten, sondern auch eine massive Erosion der Sortenkenntnis einher.
Mittlerweile hat man die Bedeutung der Sortenvielfalt unserer Streuobstwiesen endlich erkannt; doch wie lässt sich der verbliebene Sortenschatz heben und sichern? Dabei treten zwei Hauptschwierigkeiten zu Tage: da über Jahrzehnte kaum mehr nachgepflanzt wurde, und wenn, dann mit einem ziemlich einheitlichen Standardsortiment, sitzen seltene Sorten vor allem auf alten bzw. sogar abgängigen Bäumen. Bei einem prognostizierten Verlust von ca. 100.000 Bäumen pro Jahr allein in Bayern läuft uns die Zeit davon. Zweites Problem: es gibt viel zu wenige Pomologen mit guter Sortenkenntnis, und diese sind oft bereits recht betagt. Sortenkartierungen vor Ort sind nur noch punktuell möglich.
Zielsetzung
Bei diesem Vorhaben zur Umsetzung des Bayerischen Streuobstpakts galt es, eine neue, rationelle und schnellere Erfassungsmethodik für Obstsorten zu entwickeln und in Pilotlandkreisen zu testen, die auf verstärkten Einsatz Ehrenamtlicher setzt (Citizen Science).
Methodik
Im Rahmen von Sammelaktionen und mehreren Bestimmungstagen in sechs Pilotlandkreisen (seit 2021 Landshut und Kitzingen, ab 2022 Schwandorf und Dachau und 2024 Wunsiedel und Neustadt a. d. Aisch) trafen Früchte der einzelnen Bürger auf das Wissen renommierter Pomologen an 2-3 Bestimmungstagen vor Ort. Die Sorten, die dabei nicht bestimmt werden konnten, gingen weiter ans Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB) oder in die Hände anderer hochrangiger Experten. Die Bewertung der einzelnen Sorten auf Streuobsttauglichkeit und Erhaltungswert wurde zusammen mit dem Pomologen Hans-Joachim Bannier ausgearbeitet. Daraus wurden Maßnahmen zur Sortenerhaltung abgeleitet. Das Projekt lief von 2021 bis 2024 und hatte zunächst das Kernobst im Fokus (Apfel, Birne, Quitte); ab 2023 wurde die Erfassungsmethodik für Steinobst ebenfalls erprobt. Genetische Fingerprints zum Abgleich mit vorhandenen Referenzmustern ergänzten das Programm. Welche Sortenerhaltungsmaßnahmen bereits im Freistaat bestehen und welche beispielhaft und nachahmenswert sind, wurde aus einer Umfrage unter den Kreisfachberaterinnen und -beratern für Gartenkultur und Landespflege abgeleitet. Ziel ist, alte Regional- und Lokalsorten bayernweit zu bewahren, zu vermehren und letztendlich die ganze Geschmacksvielfalt auch in Zukunft genießen zu können.
Ergebnis
Es wurde eine leicht umsetzbare und kostengünstige Erfassungsmethodik erarbeitet, die für alle Landkreise und Gemeinden im Freistaat als nachahmenswertes Beispiel für eigene Erhebungen dienen soll. Die Bestimmungsquote erreichte etwa 80-85% der vorgelegten Früchte.
Der Leitfaden ist in einer Kurz- und einer Langform auf der Homepage der LWG abrufbar:
Zur Übersichtsseite
Projektdaten:
Projektleitung: Martin Degenbeck
Projektbearbeiterin: Christine Gleißner ab 01.07.2022
Pomologische Beratung: Hans-Joachim Bannier
Laufzeit: 01.06.2022 bis 31.10.2024
Finanzierung: Bayer. Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten