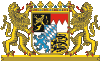Forschungs- und Innovationsprojekt
Alternatives Verfahren zur Beikrautregulierung (ABOWPrax)
Entwicklung eines alternativen Verfahrens zur Beikrautregulierung im Obst- und Weinbau zur Praxisreife
Im Rahmen des Projekts wird ein alternatives Verfahren zur Beikrautregulierung weiterentwickelt, das auf einem aufspritzbaren, biologisch abbaubaren Mulchmaterial aus Nachwachsenden Rohstoffen basiert. Die Wirkungsweise des Materials beruht auf einer physikalischen Barriere, die das Keimen und Wachstum von Beikräutern hemmt.
Ziel des Projekts
Im Vorgängerprojekt (Fördernummer G2/N/18/09) wurde das aufspritzbare Mulchverfahren entwickelt und in ersten Feldversuchen erprobt. Dort zeigte sich, dass der Einsatz des Mulchmaterials im Vergleich zur mechanischen Beikrautregulierung eine vergleichbare, langanhaltende Beikrautunterdrückung ermöglicht und gleichzeitig die Risiken mechanischer Bodenbearbeitung minimiert. Da das Mulchmaterial nur einmal jährlich appliziert wird, entfallen negative Effekte, die durch den wiederholten Einsatz von Bodenbearbeitungsgeräten an den Rebstöcken oder am Boden entstehen könnten.
Im aktuellen Projekt, das sich im letzten Förderjahr befindet, liegt der Fokus auf der umfassenden Evaluation des Verfahrens unter praxisnahen Bedingungen. Neben der Untersuchung der Wirkung auf das Beikraut werden wichtige weinbauliche Parameter erfasst – darunter:
- Ertragsdaten (kg/Rebe)
- vegetatives Wachstum (Schnittholzgewicht)
- Reifeverlauf und Mostqualität sowie
- verschiedene Bodenparameter wie Bodenfeuchte, Stickstoffmineralisierung, Gasaustausch und Bodentemperatur
Methode des Projektes
In einem Feldversuch an Silvaner-Reben in der Lage Thüngersheimer Ravensburg werden insgesamt acht Behandlungsvarianten getestet – eine unbehandelte Kontrolle, eine mechanische Beikrautregulierung sowie sechs unterschiedliche Mulchapplikationen, die sich durch drei Applikationszeitpunkte im Frühjahr (Vorauflauf im März, Nachauflauf Anfang April und Ende April/Anfang Mai) jeweils in zwei Schichtdicken (2,5 mm und 5 mm) unterscheiden.
Das Hydrauliksystem arbeitet mit einem maximalen Druck von 200 bar und bietet eine Pumpenleistung von etwa 20 l/min pro Phase. Integrierte Befüll- und Rührfunktionen in den Tanks gewährleisten eine kontinuierliche Durchmischung und reduzieren die Sedimentbildung. Die Ausbringungsmenge wird durch die einstellbare Fahrgeschwindigkeit geregelt (etwa 5 mm bei 1,6 km/h und 2,5 mm bei 3,2 km/h). Das Gerät wurde im Herbst 2024 fertiggestellt und wird ab Frühjahr 2025 in Feldversuchen an der LWG getestet.
Aktivierung erforderlich
Durch das Klicken auf diesen Text werden in Zukunft YouTube-Videos im gesamten Internetauftritt eingeblendet.Aus Datenschutzgründen weisen wir darauf hin, dass nach der dauerhaften Aktivierung Daten an YouTube übermittelt werden.
Auf unserer Seite zum Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen und können diese Aktivierung wieder rückgängig machen.
Ergebnisse des Projekts
Die Ergebnisse werden im Laufe und am Ende des Projekts hier zur Verfügung gestellt
Weiterführende Informationen
Obwohl die bisherigen Ergebnisse vielversprechend sind, bedarf es weiterer Optimierungen hinsichtlich des Materialeinsatzes und der Applikation, um die praktische Umsetzung zu verbessern und die Voraussetzungen für eine breitere Anwendung zu schaffen. Zukünftige Studien werden zudem den Einfluss des Mulchmaterials auf weitere Umweltparameter vertiefend analysieren.
Informationen und Ergebnisse aus dem Vorgängerprojekt
Projektinformationen:
Projektleitung: Gesamtvorhaben und Teilvorhaben TFZ: Dr. Edgar Remmele
Teilvorhaben LWG: Dr. Daniel Heßdörfer
Projektbearbeiter: Dr. Michael Kirchinger (TFZ), Anja Menger (LWG-IWO1)
Projektlaufzeit: 01.01.2023 bis 31.12.2025
Finanzierung: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus
Förderkennzeichen: G2/N/22/08
Projektpartner: Technologie- und Förderzentrum (TFZ), Landtechnikhersteller: Hans Wanner GmbH Maschinenbau