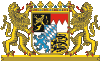Forschungs- und Innovationsprojekt
Autonome Mähsysteme für eine effektive biodiversitätsfördernde Pflege

Als Weiterentwicklung ferngesteuerter Böschungsmäher arbeiten einige Maschinenhersteller bereits an autonomen Steuerungen für Ihre Geräte. Wie lässt sich diese Innovation nun nutzen, um Insekten und andere Tiere zu schonen und damit die Biodiversität insbesondere im Straßenbegleitgrün zu fördern? Diese Frage sollte ein vom StMELF gefördertes Forschungs- und Innovationsprojekt der LWG klären.
Zielsetzung
Wie das Volksbegehren "Rettet die Bienen" gezeigt hat, fordert die Gesellschaft bei der Pflege und Unterhaltung von Grünflächen, etwa im Straßenbegleitgrün, die Förderung der Biodiversität in den Vordergrund zu rücken. Zudem haben Behörden und Kommunen gemäß Art. 1 BayNatSchG hierbei eine Vorbildfunktion.
Die folgerichtige Umstellung vom bislang weit verbreiteten Mulchschnitt etwa an Straßenböschungen auf biodiversitätsfördernden Schnitt mit Messerbalken führt zu erheblichem Mehraufwand, da das Mähgut entfernt werden muss. Hier können autonome Mähsysteme einen wichtigen Beitrag leisten; erste Prototypen gibt es bereits, bislang meist mit Mulchern ausgestattet, als Weiterentwicklung ferngesteuerter Geräteträger-Raupen, die vor allem an Straßenböschungen zum Einsatz kommen. Diese Geräte galt es nun, in Abstimmung mit den Herstellern und Entwicklern der Steuerungs-Software, für verschiedene Einsatzbereiche in der Landschaftspflege mit verschiedenen biodiversitätsfördernden Anbaugeräten zu testen, zu bewerten und weiterzuentwickeln. Neben ökologischen Fragen sollten auch arbeits- und betriebswirtschaftliche Aspekte betrachtet werden.
Methodik
In einer Metastudie sollte vorab geklärt werden, welche Lösungsansätze für eine biodiversitätsfördernde Pflege erfolgversprechend und praxisgerecht sein könnten. Geeignete Stellschrauben der Biodiversität für den Mäh- und Abräumvorgang sollten mit entsprechenden Geräteträgern und Anbaugeräten identifiziert werden, um die Zielvorgabe "Schonung von Tier und Pflanze" optimieren zu können.
Hierzu entwickelte die LWG in Zusammenarbeit mit Maschinen- und Softwareherstellern autonome Steuerungen unter dem Aspekt der Biodiversität weiter. Die vorgesehenen Untersuchungen fanden einerseits auf Flächen der LWG-Versuchsbetriebe statt, andererseits auf öffentlichen Flächen des Straßenbegleitgrüns (Straßenböschungen) in Bayern und in eingezäunten Freiflächenphotovoltaikparks. Das Versuchsdesign wurde dabei laufend weiterentwickelt.
Um die Effekte auf die Tier- und Pflanzenwelt unterschiedlicher Mäh- und Mulchvarianten bewerten zu können, wurde ein geeignetes Biomonitoring-Konzept erarbeitet. Vor Versuchsbeginn war hierzu im Jahr 2022 auf den Versuchsflächen eine Status-Quo-Erfassung notwendig. In den Jahren 2023 und 2024 wurden faunistische Begleituntersuchungen durchgeführt.
Ergebnisse
Mithilfe der satellitengestützten Lenkung werden nach dem teach-in-Prozess Überlappungen bei der Anschlussfahrt minimiert, sodass der Eingriff und die Schädigung der Wiesenfauna verringert werden können, wie wir nachweisen konnten. Mit autonomen Mähsystemen lassen sich weiterhin tierschonende Befahrmuster exakter einhalten sowie Altgrasstreifen sehr effektiv anlegen und managen. So kann die Breite der Altgrasstreifen an die Maschinenarbeitsbreite angepasst werden. Die Spurlinien der Altgrasstreifen können dann im folgenden Jahr gezielt gemäht werden, um Verbuschung zu vermeiden.
Das Abräumen ist im Gegensatz zum Mähen als Fahraufgabe im autonomen Modus deutlich anspruchsvoller und daher besteht hier noch viel Entwicklungsaufwand insbesondere an Überwachungssensorik.
Da voll autonom fahrende Mäher Sicherheitsrisiken an Straßenböschungen beinhalten, wurden Tests in eingezäunten Freiflächen-Photovoltaikparks durchgeführt, welche erfolgreich verliefen. Insgesamt konnten durch das FuE-Projekt deutliche Fortschritte bei der Weiterentwicklung autonomer Steuerungen in Bezug auf Förderung der Biodiversität erzielt werden. Es besteht allerdings noch erheblicher Entwicklungsbedarf.
Ausgewählte Publikationen
Zur Übersichtsseite
Projektdaten:
Projektleitung: Martin Degenbeck
Projektbearbeiter: Gerhard Hetz ab 1.5.2022; Dr. Elena Krimmer und Dr. Mariela Schenk (Biomonitoring),
Laufzeit: 01.01.2022 bis 31.01.2025
Finanzierung: Bayer. Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus
Förderkennzeichen: A/21/12